Solidarische Netzwerke gegen den stressigen Alltag
Dabei bleiben - Alles einer Frage der Organisierung?! Nachbetrachtung eines Diskussionsabends
von Mo Seyfried | veröffentlicht am 29.01 2018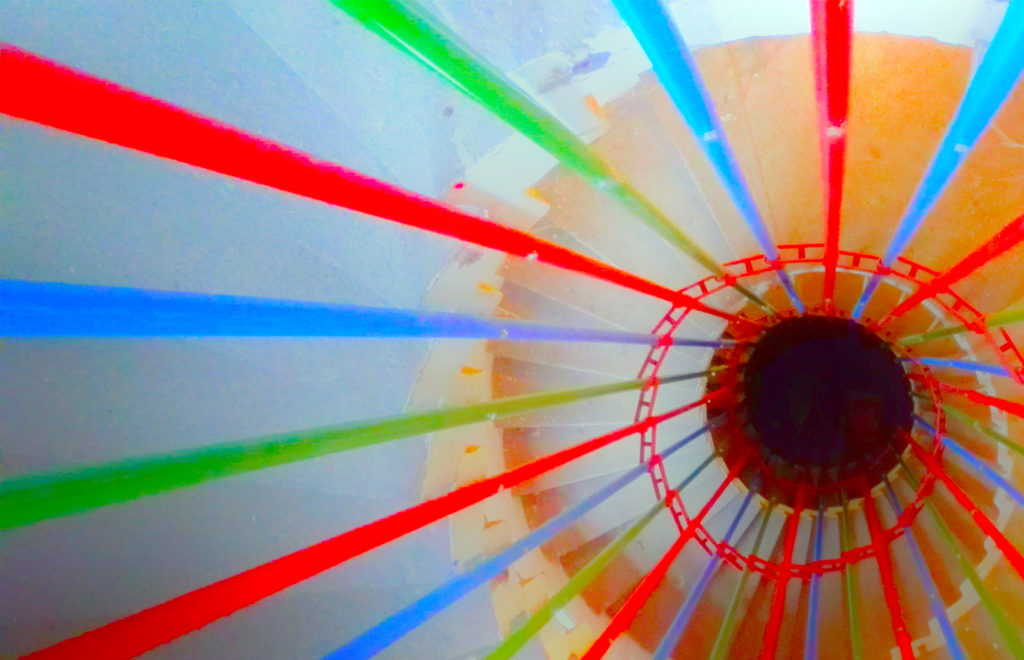
Beitragsbild: per.spectre
In Leipzig gab die Veranstaltungsreihe „Salon gegen den Ausstieg“ Anlass zur Auseinandersetzung mit der Vereinbarkeit von linker Politarbeit und dem Leben jenseits des Studidaseins. Dass es selbst so eine Reihe schon schwer hat, diesem Anspruch gerecht zu werden, zeigt dieser Beitrag.
Langsam tröpfeln die Leute ein. Die Sitzplätze im Leipziger UT Connewitz sind etwa zu einem Drittel besetzt, als es 20 Minuten später als angekündigt losgeht. Leipziger Linke treffen sich, um über die Vereinbarkeit von Lohn- und Politarbeit zu diskutieren.
Ich bin gespannt was mich erwartet, denn die Frage des Abends ist auch eine Frage, die mich als noch relativ frisch Festangestellte in einem nicht-linken Arbeitsbereich mit 40h-Woche stark beschäftigt. Wie kann ich mich organisieren, um mich trotz knapper Zeit für linke Politik einzusetzen, die Szene nicht komplett aus den Augen zu verlieren und auch irgendwie noch Zeit zur Reproduktion, für meine Beziehungen und zur Erholung zu haben? Welche Modelle haben Menschen jenseits des szeneüblichen Studi-Daseins gefunden?
Auf dem Podium sitzen Niko, der über die kollektive betriebliche Organisierung von Sozialarbeiter*innen sprechen wird, Henning von der AG Antrag/Autonomen Erwerbsloseninitiative, Maria vom „autonomen Gemischtwarenladen“ Bambule und Maik von der sich im Aufbau befindlichen Betriebsgruppe des Lieferservice Foodora. Angekündigt wird nach einer kurzen Vorstellung dieser vier unterschiedlichen Ansätze zum Umgang mit Lohnarbeit bzw. der individuellen Betroffenheit von Verwertungslogiken, die Methode des Fishbowls, um auch mit den anwesenden Besucher*innen ins Gespräch zu kommen.
Als erstes stellt Henning die Erwerbsloseninitiative vor, die sich einmal im Monat trifft. Die Erwerbslosenini versteht sich als kollektive Beratung, in der Hartz-4-Bezieher*innen und Freund*innen gemeinsam Strategien entwickeln, wie die/der Einzelne dem Jobcenter gegenübertreten kann. Dabei geht es um die Vermittlung von Erfahrungswerten und angeeignetem Wissen im Umgang mit der Behörde. Wichtigstes Anliegen der Initiative ist, dass die betroffenen Menschen wissen, was ihre Rechte sind und was das Jobcenter darf und was nicht. Der Gang zum Jobcenter wird als eine Möglichkeit besprochen, sich die politische Arbeit, die ja oft nicht oder nur schlecht bezahlt ist, zu finanzieren. Das Geld der Behörde wird in dieser Sichtweise zu einer Art Grundeinkommen, auf dessen Basis sich politisch und unbezahlt arbeiten lässt.
Maria hat ein anderes Modell gefunden. Zusammen mit einer Genoss*in gründete sie vor etwa einem Jahr das Ladenkollektiv Bambule. Hier gibt es alles für den täglichen linken Szene-Bedarf: Hoodies, Mützen und T-Shirts mit oder ohne politischer Botschaft, Kampfsportausrüstung und vieles mehr. Es ist der Versuch, linksradikale und solidarische Ansprüche ganz direkt mit der Notwendigkeit, Geld zu verdienen zu verknüpfen. Daher, sagt sie, war es nur folgerichtig, sich als Kollektiv zu organisieren. Für Maria und ihre Partner*in liegen die Vorteile dieses Modells auf der Hand: Sie können mit Leuten arbeiten, die sie mögen und müssen sich nicht voreinander verstellen. Es gibt ein Grundverständnis für die jeweiligen Bedürfnisse. „Zum Beispiel muss ich mich nicht groß erklären, wenn ich frage, ob jemand anderes meine Samstagsschicht übernehmen kann, da ich zur Demo will“, erläutert Maria. Allerdings steckt Bambule in den üblichen Widersprüchen des Lebens im Kapitalismus. Dies wird an einem Punkt besonders deutlich: um als Laden dauerhaft zu funktionieren, so dass die Kosten gedeckt und die Betreiber*innen davon leben können, müssen Maria und ihre Genoss*innen kapitalistisch wirtschaften, da dies das herrschende Wirtschaftssystem ist. Schwierig als Antikapitalist*innen. Momentan trage sich der Laden zudem noch nicht selbst. Doch Maria ist guter Dinge. Noch halten der Spaß an der Sache und ihr Ansatz, so der Szene etwas zurückgeben zu können, den Laden am Laufen.
Niko stellt relativ allgemein Arbeitskämpfe im Bereich der sozialen Arbeit vor. Er eröffnet damit ein Feld von Auseinandersetzung eines urlinken Themas, des Arbeitskampfes in einem nicht explizit linken Arbeitsbereich. Soziale Arbeit sei in dem Fall als ein Sammelbegriff zu verstehen für z.B. Einzelfallhilfe, offene Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit. Zunächst spricht Niko zur Notwendigkeit von Arbeitskämpfen im Bereich der sozialen Arbeit. Wesentlich seien hierbei die Arbeitsbedingungen: sinkende Löhne, Arbeitsverdichtung (z.B. beim Betreuungsschlüssel) und befristete Stellen. Unter den Beschäftigten gäbe es massive Probleme, sich zu organisieren. Die Gründe dafür fänden sich in den Arbeitsbedingungen selbst: einzelne Teams bestehen aus sehr wenigen Leuten, dafür gibt es viele Teams, die in Konkurrenz zueinander stehen. Sozialarbeiter*innen organisieren und kommunizieren den ganzen Tag, haben daher abends wenig Kraft, dasselbe für die eigene betriebliche Organisierung weiter zu tun. Ein weiterer entscheidender Grund liegt im Charakter der Carearbeit. Wenn Sozialarbeiter*innen streiken, geht das zunächst zu Lasten ihrer Klient*innen, der unterstützungsbedürftigen Menschen. Trotz der realistischen Einschätzung des Ist-Zustandes, gibt Niko im Anschluss einen Ausblick in Hinsicht von Möglichkeiten einer emanzipatorischen Organisierung auf zwei Wegen: der erste führe über die Gewerkschaften. 25% aller Sozialarbeiter*innen sind in Gewerkschaften, davon 80% bei ver.di. Er sieht die Möglichkeit einer Demokratisierung von Gewerkschaften, wie sie z.B. 2015 bei den Streikdelegiertenkonferenzen stattgefunden hatte. Möglichkeiten der betrieblichen Organisierung im Bereich der Sozialen Arbeit gäbe es aber auch außergewerkschaftlich: im Care Revolution Netzwerk z.B. befinden sich derzeit etwa 80 Gruppen (u.a. verdi, IL). Außerdem existiert in Leipzig ein Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit.
Als letztes wird von Maik der Arbeitskampf beim Essenslieferanten Foodora vorgestellt. Etwa einen Monat zuvor hatte sich zusammen mit der FAU Halle/Leipzig eine Betriebsgruppe gegründet. Zum Zeitpunkt der Veranstaltung war die Arbeit der Betriebsgruppe noch ganz frisch, weswegen es viel mehr um die aktuellen Arbeitsbedingungen bei Foodora ging: die Arbeitsbedingungen dort sind mies: die Fahrradkuriere erhalten lediglich 9€/Stundenlohn, müssen mit ihren eigenen Fahrrädern fahren und erhalten dafür keine Reparaturpauschale, sie müssen ihre eigenen Telefone benutzen, mit denen sie während der Schicht permanent online sein müssen und zudem permanent getrackt werden. Sie bekommen zwar Arbeitsbekleidung, aber schlechte. Der Wettbewerb der einzelnen untereinander wird v.a. dadurch extrem verstärkt, dass die Foodora App Statistiken über die einzelnen Fahrradfahrer*innen erstellt. Die Organisierung erfolgte bis dato über „Rumhängplätze“, die sich aufgrund der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Raum ergeben hatten (z.B. auf einem Warmluftschacht vor einem Supermarkt in der Nähe der Uni). Inzwischen scheint sich die Organisierung verstärkt zu haben (s. FAU Halle/Leipzig)
Im Anschluss an die Vorstellungen soll nach der Fishbowl Methode über das gehörte und eigene Erfahrungen zum Thema diskutiert werden. Diesen Teil werde ich allerdings nicht abwarten, da auf die Verspätung nach einer Stunde eine Raucher*innenpause folgt und mir als 9 to 5 Lohnarbeitender der Abend zu lang wird.
Dennoch fand ich die Kombination der verschiedenen Ansätze zum Thema sehr interessant. Lohnarbeitslosigkeit, um sich den Rücken für die politische Arbeit frei zu halten, der Gang in die kollektive Selbstständigkeit oder der Arbeitskampf im klassischen Lohnarbeitsverhältnis. Doch bei allen Modellen bleiben ähnliche Probleme bestehen: habe ich nach einem ganzen Tag mich mit Behörden und Antragsformularen herumärgern / im Detail vielleicht doch stumpfen Sortieren von Pullis nach Größen oder / Lohnarbeitstag noch genug Kraft, mich politisch zu betätigen oder auch einfach nur Freund*innen zu treffen? Oder hab ich vielleicht trotz allem zu wenig Geld, um langfristig zu denken? Oder geht mir der gesellschaftlich zugewiesene (oder freigewählte) Platz am Rande der Gesellschaft trotz der gegenseitigen Unterstützung doch ganz schön an die Nieren?
Nachdem ich den Leuten von Dabeigeblieben eine E-Mail als Feedback auf die Veranstaltung und ihre leider ungünstigen Grundvoraussetzungen für Lohnarbeitende geschrieben hatte, bekam ich einige Wochen später eine sehr ausführliche und verständnisvolle E-Mail zurück mit dem Hinweis, dass auch sie als Gruppe, den multiplen Anforderungen von Lohnarbeit plus politischem Anspruch zunächst nicht mehr gerecht werden können und die Reihe erst mal nicht fortführen können. Dennoch ist es wichtig, dass es diesen Anstoß gegeben hat und ich hoffe, dass die Diskussion auf anderen Wegen fortgesetzt wird.
Der Beitrag gibt nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.
